Handeln Sie für Ihr Konto.
MAM | PAMM | POA.
Forex-Prop-Firma | Vermögensverwaltung | Große Privatfonds.
Offizieller Start ab 500.000 US-Dollar, Test ab 50.000 US-Dollar.
Gewinne werden zur Hälfte (50 %) und Verluste zu einem Viertel (25 %) geteilt.
*Kein Unterricht *Kein Kursverkauf *Keine Diskussion *Wenn ja, keine Antwort!
Foreign Exchange Multi-Account Manager Z-X-N
Akzeptiert den Betrieb, die Investitionen und die Transaktionen globaler Devisenkontoagenturen
Unterstützen Sie Family Offices bei der autonomen Vermögensverwaltung
Im Devisenhandel zeichnen sich erfahrene Anleger in der Regel durch eine ausgeprägte Reife aus, Kapital ist jedoch oft ihre knappste Ressource.
Ausreichendes Kapital ist bei Deviseninvestitionen entscheidend, wichtiger als jeder andere Faktor. Mit ausreichend Kapital entwickeln Anleger eine ruhigere Denkweise und treffen rationalere Anlageentscheidungen. Diese Rationalität verhindert, dass sie schnell auf Ergebnisse aus sind, und führt dazu, dass sie langfristige Anlage- und Haltestrategien verfolgen, anstatt blind auf schnelle Gewinne zu setzen.
Anleger mit ausreichend Kapital sind vorsichtiger, was zur Risikominderung beiträgt. Mit effektiven Risikomanagementmaßnahmen erleiden sie in kurzer Zeit weniger hohe Verluste. Durch kontinuierliches Lernen und Übung erleiden sie selbst bei schlechten Marktbedingungen keine nennenswerten Verluste, selbst wenn sie innerhalb eines Jahres keinen Gewinn erzielen.
Im Gegenteil: Ausreichendes Kapital ermöglicht es Anlegern, entspannt zu bleiben und Investitionen als Freizeitbeschäftigung und nicht als riskantes Glücksspiel zu betrachten. Dieser Mentalitätswandel ist entscheidend für langfristige, stabile Investitionen. Er hilft Anlegern nicht nur, angesichts von Marktschwankungen gelassen zu bleiben, sondern auch, langfristige Anlagechancen besser zu nutzen und ein stetiges Vermögenswachstum zu erzielen.
Quellen der Plattformliquidität und Gewinn- und Verluststrategien für Trader im Forex-Handel.
Wenn Trader im Forex-Handel die wichtigsten Quellen der Plattformliquidität und die Funktionsweise verschiedener Liquiditätsmodelle genau verstehen, können sie das Handelsumfeld rationaler einschätzen, operative Strategien entwickeln und Gewinne und Verluste gelassener managen. So vermeiden sie irrationale Handelsfehler, die durch ein vages Verständnis der Plattformmechanismen entstehen.
Forex-Plattformen bieten Liquidität in erster Linie in zwei Kernmodellen. Das erste ist das direkte Market-Maker-Modell (MM-Modell). Solche Plattformen benötigen lediglich eine Market-Maker-Lizenz, um entsprechende Geschäfte tätigen zu können. Aus operativer Sicht ist das Kernmerkmal des Market-Maker-Modells die interne Abwicklung von Kundenaufträgen. Dieses Modell funktioniert auf zwei Arten: Erstens nimmt die Plattform Kundenaufträge direkt entgegen, wird zur Gegenpartei des Kunden und geht eine Wettbeziehung mit ihm ein. Zweitens nutzt die Plattform ihr internes System, um Long- und Short-Orders verschiedener Kunden zu matchen und so eine Handelskontrahentin zwischen den Kunden zu schaffen, ohne Aufträge an den externen Markt übermitteln zu müssen. Bei diesem Modell gelangen Kundenaufträge nicht zur tatsächlichen Ausführung auf den globalen Devisenmarkt. Die Plattform gleicht Risiko und Ertrag aus, indem sie den Auftragsfluss kontrolliert und gleichzeitig Einnahmen durch Spreads, Provisionen und andere Mittel generiert.
Das zweite Liquiditätsbereitstellungsmodell umfasst Plattformen, die mit externen Liquiditätsanbietern (LPs) interagieren. In Finanzmärkten wie Devisen und Aktien sind Liquiditätsanbieter typischerweise Institutionen mit starken Finanzressourcen und aufsichtsrechtlicher Compliance, darunter große Geschäftsbanken (wie JPMorgan Chase und HSBC), spezialisierte Finanzinstitute und große Handelsunternehmen. Die Kernfunktion dieser Institute besteht darin, Liquidität in den Markt zu bringen und reibungslose Transaktionen zu ermöglichen, indem sie kontinuierlich Kauf- und Verkaufskurse bereitstellen und proaktiv die Verpflichtung zum Kauf und Verkauf von Vermögenswerten übernehmen. Wenn ein Händler eine Order auf der Plattform platziert, leitet die Plattform diese an einen Partner-Liquiditätsanbieter weiter, der dann die endgültige Markttransaktion abschließt. In dieser Rolle fungiert die Plattform eher als „Ordervermittler“ und profitiert von Provisionen oder Servicegebühren der Liquiditätsanbieter.
Zusätzlich zu den beiden oben genannten Einzelmodellen setzen die meisten Forex-Plattform-Broker auf ein „Hybridmodell“, bei dem ihre Auftragsabwicklungsmethoden flexibel an spezifische Umstände wie Auftragsgröße und Kundentyp angepasst werden. Insbesondere leitet die Plattform einige Aufträge an den externen Markt weiter (d. h. über ein Liquiditätsanbietermodell). Diese Aufträge werden allgemein als „Marktaufträge“ bezeichnet und zielen in erster Linie auf die Handelsbedürfnisse von „Warehouse A-Kunden“ ab. In der Regel sind Warehouse A-Kunden Großinvestoren mit großen Aufträgen. Würde die Plattform ein internes Market-Making-Modell einsetzen, wäre dies mit erheblichen Risiken verbunden (wenn der Markttrend mit der Kundenorder übereinstimmt, könnte die Plattform erhebliche Verluste erleiden). Daher wird das Risiko durch die Weiterleitung dieser Großaufträge an den externen Markt effektiv diversifiziert. Gleichzeitig wickelt die Plattform einen anderen Teil dieser Aufträge intern über ein Market-Making-Modell ab. Diese Aufträge stammen typischerweise von Kleinanlegern mit geringem Kapitaleinsatz. Aufgrund ihres geringeren Volumens kann die Plattform sie durch internes Matching oder Selbstakzeptanz abwickeln, ohne die allgemeine Risikotoleranz der Plattform wesentlich zu beeinträchtigen. Dieses flexible Hybridmodell gewährleistet das Risikomanagement der Plattform und erfüllt gleichzeitig die Handelsanforderungen unterschiedlicher Kundentypen. Es ist eine gängige Betriebsoption in der aktuellen Forex-Plattformbranche.
Für Forex-Händler ist ein klares Verständnis der Liquiditätsquellen der Plattform entscheidend, um Gewinne und Verluste rational zu managen und solide Handelsstrategien zu entwickeln. Basierend auf einem Verständnis der Liquiditätsmodelle sollten Händler blindes Engagement im kurzfristigen, schwergewichtigen Handel vermeiden. Kurzfristiger Handel nutzt kurzfristige Marktschwankungen, um Gewinne zu erzielen. Verschiedene Liquiditätsmodelle unterscheiden sich hinsichtlich der Geschwindigkeit der Auftragsausführung und des Slippage-Risikos. (Beispielsweise kann es beim Market-Maker-Modell zu Slippage aufgrund interner Auftragserfüllung kommen, insbesondere in Zeiten hoher Marktvolatilität.) Schwergewichtiger Handel kann diese Risiken verstärken, und Fehleinschätzungen können zu erheblichen Verlusten führen. Darüber hinaus kann kurzfristiger, schwergewichtiger Handel leicht emotionale Schwankungen auslösen, die Händler angesichts kurzfristiger Gewinne und Verluste zu impulsiven Entscheidungen verleiten, was das Risiko weiter erhöht.
Im Gegensatz dazu ist eine leichtgewichtige, langfristige Handelsstrategie stabiler und steht im Einklang mit einem rationalen Verständnis der Plattform-Liquiditätsmodelle. Leichtgewichtige, langfristige Händler streben nicht nach schnellen Gewinnen. Stattdessen warten sie geduldig auf hochwertige Handelsmöglichkeiten, basierend auf ihrem Verständnis langfristiger Markttrends. Nach dem Aufbau einer anfänglichen Position erhöhen sie ihre Positionen schrittweise in kleinen Schritten, wenn die Markttrends den Erwartungen entsprechen und die nicht realisierten Gewinne ein bestimmtes Niveau erreichen. So erzielen sie durch die Anhäufung stetiger, kleiner Gewinne einen langfristigen Vermögenszuwachs. Aus Sicht des Risikomanagements reduziert eine geringe Position effektiv den potenziellen Verlust eines einzelnen Handels. Selbst bei kurzfristigen Marktschwankungen oder Slippage aufgrund der Plattformliquidität vermeidet sie die Fallstricke einer zu hohen Positionsinvestition. Aus Sicht des Emotionsmanagements ermöglicht eine langfristige Strategie den Händlern, sich weniger auf kurzfristige Gewinne und Verluste zu konzentrieren. Dies wirkt sowohl der Angst vor schwebenden Verlusten als auch der Gier nach kurzfristigen Gewinnen entgegen und ermöglicht so rationale Handelsentscheidungen.
Umgekehrt erschwert ein starker kurzfristiger Handel nicht nur die Vermeidung emotionaler Einflüsse, sondern erhöht auch die Wahrscheinlichkeit operativer Fehler aufgrund der kombinierten Effekte von kurzfristigen Marktschwankungen und Plattformliquidität. Beispielsweise können kurzfristige hohe Positionen in einem Market-Maker-Modell zu erheblicher Slippage führen, wenn sie mit dem internen Risiko der Plattform in Konflikt geraten. In einem Liquiditätsanbietermodell können kurzfristig hohe Positionen aufgrund vorübergehender Liquiditätsengpässe zu Ausführungsverzögerungen führen. Diese Faktoren erhöhen die Handelsrisiken und führen letztendlich dazu, dass Händler ihre Strategien häufig emotional anpassen und in einen Teufelskreis aus Verlusten, Angst und Fehlern geraten. Nur ein umfassendes Verständnis der Plattformliquiditätsquellen ermöglicht es Händlern, die Eignung verschiedener Handelsstrategien grundlegend zu verstehen. Durch die Wahl einer stabilen, langfristigen Strategie mit geringer Position können sie Gewinne und Verluste rational managen und ihre langfristigen Handelsziele erreichen.
Im Devisenhandel sind Anleger häufig von Marktschwankungen betroffen, und ihre Emotionen schwanken entsprechend. Um dies zu vermeiden, können sich Anleger auf drei Aspekte konzentrieren: Vorbereitung vor dem Handel, emotionale Kontrolle während des Handels sowie Reflexion und Anpassung nach dem Handel.
Die Vorbereitung vor dem Handel ist entscheidend. Zunächst müssen Anleger einen klaren Handelsplan entwickeln. Dazu gehört die klare Definition ihrer Handelsziele, beispielsweise die Festlegung eines angemessenen Gewinnziels, beispielsweise eines monatlichen Gewinnziels von 10 bis 20 % des Anfangskapitals. Die Festlegung eines Stop-Loss-Punktes ist ebenfalls entscheidend, um Verluste zu begrenzen. Fällt beispielsweise nach dem Kauf eines Währungspaares der Kurs unter den festgelegten Stop-Loss-Punkt, beispielsweise 5 % unter den Kaufpreis, sollte entschieden verkauft werden, um weitere Verluste zu vermeiden. Anleger sollten außerdem eine geeignete Handelsstrategie basierend auf ihrem Handelsstil wählen, z. B. kurzfristiges Trading oder langfristiges Investieren. Beim kurzfristigen Trading können Sie sich auf technische Analyseindikatoren wie gleitende Durchschnitte konzentrieren. Wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt einen langfristigen gleitenden Durchschnitt überschreitet, kann dies ein Kaufsignal sein; wenn er diesen überschreitet, kann dies ein Verkaufssignal sein. Bei langfristigen Investitionen können Sie sich auf wirtschaftliche Fundamentaldaten wie die Zinspolitik und die Inflationsrate eines Landes konzentrieren. Beispielsweise können anhaltende Zinserhöhungen eines Landes Kapitalzuflüsse in seine Währung anziehen und deren Wert steigern.
Perfekte Marktforschung ist ebenfalls unerlässlich. Anleger müssen die Grundlagen des Devisenmarktes verstehen. Als weltweit größter Finanzmarkt werden seine Kursschwankungen von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, darunter Wirtschaftsdaten (wie BIP und Arbeitslosenquoten), politische Ereignisse (wie Wahlen und Handelsabkommen) und die Marktstimmung. Beispielsweise stärken starke Wirtschaftsdaten, wie etwa ein über den Erwartungen liegendes BIP-Wachstum, oft den Wert der Landeswährung. Anleger können ihr Verständnis des Devisenhandels durch die Lektüre professioneller Finanzbücher und die Teilnahme an Devisenhandelsschulungen verbessern. Es ist außerdem wichtig, die Eigenschaften und Risiken verschiedener Handelsinstrumente wie Margin-Handel und CFDs zu verstehen. Margin-Handel kann zwar das Handelsvolumen erhöhen, erhöht aber auch das Risiko. Entgegen den Erwartungen können sich Verluste schneller anhäufen.
Ein angemessenes Kapitalmanagement ist ebenfalls entscheidend für die Handelsvorbereitung. Anleger sollten nicht ihr gesamtes Kapital in den Devisenhandel investieren. Stattdessen können sie eine Kapitalallokationsstrategie verfolgen und einen Teil für tägliche Ausgaben, Ersparnisse und andere Zwecke reservieren, um zu verhindern, dass Verluste aus dem Devisenhandel ihren Alltag beeinträchtigen. Wenn Sie beispielsweise 100.000 Yuan besitzen, könnten Sie 30.000 bis 50.000 Yuan für den Devisenhandel und den Rest für andere stabile Anlagen oder Ersparnisse verwenden. Wichtig ist auch, die Höhe des in jeden Handel investierten Kapitals im Auge zu behalten. Generell sollte der in einen einzelnen Handel investierte Betrag 10 bis 20 % Ihres gesamten Handelskapitals nicht überschreiten. Auf diese Weise stellt selbst ein Verlust bei einem bestimmten Handel keinen verheerenden Schlag für Ihr Gesamtkapital dar.
Emotionale Kontrolle ist auch beim Handel entscheidend. Anleger müssen ruhig und objektiv bleiben. Lassen Sie sich bei starken Marktschwankungen nicht von vorübergehenden Gewinnen oder Verlusten beeinflussen; treffen Sie Entscheidungen basierend auf Ihrem Handelsplan und Ihrer Strategie. Wenn der Markt beispielsweise aufgrund einer Eilmeldung (wie einer überraschenden Zinssenkung durch eine Zentralbank) plötzlich einen starken Einbruch erlebt, geraten Sie nicht in Panik und verkaufen Sie nicht alle Ihre Positionen. Analysieren Sie stattdessen die langfristigen Auswirkungen der Nachricht auf das Währungspaar, um festzustellen, ob es die Stop-Loss- oder Take-Profit-Kriterien Ihres Handelsplans erfüllt. Anleger sollten außerdem emotionales Trading vermeiden und nicht aus Gier blind Höchststände verfolgen oder aus Angst vorzeitig Verluste begrenzen. Steigt beispielsweise der Kurs eines Währungspaares stark und Sie haben bereits einen erheblichen Gewinn erzielt, zögern Sie möglicherweise mit dem Verkauf, da der Kurs weiter steigt, in der Hoffnung auf weitere Gewinne. Dies kann zu einer plötzlichen Kursumkehr und einem Rückgang führen, was die Gewinne deutlich schmälert oder sogar Verluste verursacht.
Trading-Tools zur Unterstützung des Emotionsmanagements sind ebenfalls eine effektive Methode. Anleger können Stop-Loss- und Take-Profit-Orders einsetzen. Stop-Loss-Orders können dazu beitragen, Verluste automatisch zu begrenzen, indem sie die Position automatisch schließen, wenn der Kurs den Stop-Loss-Punkt erreicht. Take-Profit-Orders können Gewinne sichern. Legen Sie beispielsweise beim Kauf von EUR/USD einen Stop-Loss-Punkt bei 1,1000 und einen Take-Profit-Punkt bei 1,1200 fest. Fällt der Kurs auf 1,1000, wird eine Stop-Loss-Order automatisch verkauft, um Verluste zu begrenzen. Steigt der Kurs auf 1,1200, wird eine Take-Profit-Order automatisch verkauft, um Gewinne zu sichern. So wird verhindert, dass Unentschlossenheit zu verpassten Stop-Loss- oder Take-Profit-Chancen führt. Anleger können außerdem ein Handelsprotokoll führen und Uhrzeit, Währungspaar, Richtung, Betrag, Grund für jeden Handel und die Ergebnisse dokumentieren. Durch die Analyse Ihres Handelsprotokolls können Sie Muster in Ihrem emotionalen Handel erkennen. Beispielsweise stellen Sie möglicherweise fest, dass Sie in Zeiten hoher Marktvolatilität zu impulsivem Handeln neigen. Durch die Aufzeichnung und Analyse Ihres Protokolls können Sie sich daran erinnern, in ähnlichen Situationen ruhig zu bleiben.
Reflexion und Anpassung nach dem Handel sind ebenso wichtig. Anleger sollten ihre Handelsaufzeichnungen regelmäßig überprüfen und analysieren, welche Geschäfte erfolgreich und welche nicht erfolgreich waren. Analysieren Sie bei erfolgreichen Trades die Gründe für den Erfolg, z. B. ob die Handelsstrategie solide war oder das Marktumfeld günstig. Identifizieren Sie bei erfolglosen Trades die Gründe für das Scheitern, z. B. ob der Handelsplan unzureichend war oder ob Ihre Emotionen zu schlechten Entscheidungen geführt haben. Wir haben beispielsweise festgestellt, dass viele fehlgeschlagene Trades darauf zurückzuführen sind, dass Stop-Loss-Strategien nicht strikt eingehalten wurden. Bei fallenden Kursen gehen Anleger Risiken ein und setzen Stop-Loss-Orders nicht rechtzeitig um, was letztendlich zu weiteren Verlusten führt. Basierend auf dieser Erfahrung müssen Anleger ihre Handelsstrategien anpassen. Wenn sie feststellen, dass ihre Handelsstrategien unter bestimmten Marktbedingungen unwirksam sind, z. B. in Zeiten hoher Volatilität, wenn ihre ursprünglichen technischen Analysestrategien wirkungslos sind, können sie erwägen, fundamentalere Analysefaktoren einzubeziehen, um ihre Strategien anzupassen. Sie sollten auch ihre Denkweise anpassen. Wenn sie feststellen, dass ihre Emotionen häufig ihr Trading beeinflussen, können sie Techniken zum Emotionsmanagement wie Meditation und tiefes Atmen erlernen, um sich zu entspannen und vor dem Trading eine ruhige Denkweise zu bewahren.
Im Devisenhandel ist es für Händler wichtig, sich klarzumachen, dass Devisenhandel grundsätzlich eine Anlage mit geringem Risiko und geringer Rendite ist. Die Gewinnstrategie basiert auf langfristiger Trendakkumulation und Risikokontrolle statt auf kurzfristiger, risikoreicher Spekulation. Für Anleger, die kurzfristig hohe Renditen durch Risikobereitschaft erzielen wollen, ist Devisenhandel keine geeignete Option. Diese Eigenschaft ist nicht durch die Zufälligkeit der Marktschwankungen bedingt, sondern vielmehr durch die Marktlandschaft, die in den letzten Jahrzehnten durch die Geldpolitik und die Wechselkursinterventionsstrategien der globalen Zentralbanken geprägt wurde. Diese beeinflussen die Risiko-Rendite-Struktur und die operative Logik des Devisenhandels direkt.
1. Die politische Ausrichtung der globalen Zentralbanken: Den Marktton mit geringem Risiko und geringer Rendite festlegen.
In den letzten Jahrzehnten hat die geldpolitische Logik der Zentralbanken wichtiger Währungsemittenten die Volatilität des Devisenmarktes grundlegend verändert und dessen Entwicklung hin zu einer Strategie mit geringem Risiko und geringer Rendite unmittelbar vorangetrieben. Um ihre Handelswettbewerbsfähigkeit zu erhalten und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, verfolgen die meisten Zentralbanken wichtiger Währungen (wie die der Eurozone, Japans und Großbritanniens) seit langem eine Strategie der „wettbewerblichen Abwertung“, indem sie die Zinssätze senken und die Liquiditätsspritzen erhöhen um die Währungsaufwertung zu unterdrücken, sind niedrige, Null- und sogar negative Zinssätze mit verschiedenen Mitteln zur Norm in der globalen Geldpolitik geworden. So hielt die Bank von Japan seit 2001 lange Zeit niedrige Zinsen und führte 2016 eine Negativzinspolitik ein. In der Eurozone herrscht seit 2014 eine Negativzinsphase, die seit über acht Jahren anhält.
In diesem geldpolitischen Umfeld sind Zentralbanken gezwungen, häufig in den Markt einzugreifen (z. B. durch direkte Devisenmarkttransaktionen, verbale Interventionen und Anpassungen der politischen Instrumente), um die Wechselkurse zu stabilisieren und zu verhindern, dass übermäßige Währungsschwankungen die wirtschaftlichen Ziele beeinträchtigen. Gerät beispielsweise die Währung eines Landes aufgrund kurzfristiger Kapitalzuflüsse unter Aufwertungsdruck, verkauft die Zentralbank ihre eigene Währung und kauft Fremdwährungen, wodurch das Angebot an Landeswährung erhöht wird und der Wechselkurs gedrückt wird. Umgekehrt kauft die Zentralbank bei einer übermäßigen Abwertung der Landeswährung ihre eigene Währung und verkauft Fremdwährungen, um die Wechselkursstabilität zu gewährleisten. Die direkte Folge dieser Intervention ist die Fixierung des Wechselkurses innerhalb einer relativ engen Schwankungsbreite, wodurch der einseitige Trend und die Volatilität des Wechselkurses deutlich reduziert werden. Dies erschwert es dem Devisenhandel, die durch hohe Volatilität bedingten Renditechancen zu nutzen, was letztlich zu einem Umfeld mit geringem Risiko, niedrigen Renditen und starker Konsolidierung führt.
2. Der Markt für kurzfristigen Handel schrumpft: Fehlende Trends führen zu knappen Chancen.
Der globale Devisenmarkt verzeichnet derzeit einen Rückgang der kurzfristigen Händler und eine reduzierte Marktaktivität. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Gewinnlogik des kurzfristigen Handels nicht mehr mit den Marktbedingungen übereinstimmt. Immer mehr kurzfristige Händler erkennen, dass sie von kurzfristigen Schwankungen am Devisenmarkt nicht mehr profitieren können und ziehen sich aktiv aus dem kurzfristigen Handel zurück. Dies verschärft die Stagnation des Marktes weiter – eine Stagnation, die nicht auf unzureichende Marktliquidität, sondern auf einen Mangel an handelbaren kurzfristigen Möglichkeiten zurückzuführen ist.
Aus Marktsicht hängen kurzfristige Handelsgewinne von kurzfristigen Trendschwankungen oder starken Schwankungen der Wechselkurse ab. Das aktuelle Zinssystem und der Wechselkurskopplungsmechanismus der wichtigsten globalen Währungen dämpfen solche Schwankungen direkt. Einerseits sind die Zinssätze der wichtigsten Währungen stark an die US-Dollar-Zinssätze gekoppelt (beispielsweise hängen Zinsanpassungen für Währungen wie Euro, Pfund und Yen häufig von der geldpolitischen Ausrichtung der Federal Reserve ab, um übermäßige Wechselkursabweichungen zu vermeiden). Diese Zinsdifferenz bewegt sich in einem extrem engen Rahmen. Zinsdifferenzen sind ein wesentlicher Treiber kurzfristiger Kapitalflüsse und Wechselkursschwankungen. Diese engen Differenzen führen unmittelbar zu einem Rückgang der grenzüberschreitenden Kapitalflüsse und einer mangelnden Dynamik für Wechselkursschwankungen. Andererseits haben regelmäßige Interventionen der Zentralbanken die Wechselkursvolatilität weiter reduziert. Die durchschnittliche tägliche Volatilität der meisten wichtigen Währungspaare (wie EUR/USD und USD/JPY) ist im Vergleich zu vor einem Jahrzehnt um 30–50 % gesunken. Sie befinden sich seit langem in einer Konsolidierungsphase ohne klaren, einseitigen Trend.
Dieses Marktumfeld mit engen Kursspannen und ohne Trend stellt kurzfristige Trader vor ein Dilemma: Sie haben Schwierigkeiten, von Preisarbitrage durch die Ausnutzung kurzfristiger Schwankungen zu profitieren und gleichzeitig Möglichkeiten für hohe Investitionen in größere Trends zu finden. Selbst wenn Anleger bereit sind, risikoreiche, stark investierte Positionen einzugehen, fehlt dem Markt das Potenzial für signifikante Gewinne. Letztendlich hat sich der kurzfristige Handel von einem Modell mit hohem Risiko und hoher Rendite zu einem Modell mit hohem Risiko und niedriger Rendite gewandelt und damit an Attraktivität für Trader verloren.
3. Breakout-Trading wird aufgegeben: Die Grundlage von Strategien zur Trendabschwächung und -zersetzung.
In den letzten zwei Jahrzehnten ist die einst im Devisenhandel weit verbreitete Strategie des „Breakout-Tradings“ (d. h. das Profitieren von einem einseitigen Trend durch das Ausnutzen eines Wechselkursausbruchs über ein wichtiges Widerstands- oder Unterstützungsniveau) allmählich in Ungnade gefallen. Der Hauptgrund dafür ist die deutliche Abschwächung des Devisenmarkttrends, die der Strategie ihre fundamentale Marktbasis entzogen hat.
Die Effektivität des Breakout-Tradings hängt maßgeblich von einem anhaltenden einseitigen Wechselkurstrend ab. Sobald der Wechselkurs ein wichtiges Niveau durchbricht, muss sich ein nachhaltiger Trend bilden, damit Händler ausreichende Gewinne erzielen können. Das aktuelle globale Devisenmarktumfeld erfüllt diese Anforderungen jedoch nicht. Erstens sind Interventionen der Zentralbanken zur Routine geworden. Die großen Zentralbanken halten die Wechselkurse durch regelmäßige Operationen innerhalb ihrer Zielspannen. Selbst wenn die Wechselkurse gelegentlich wichtige Niveaus durchbrechen, werden sie durch Zentralbankinterventionen oft wieder in diese Spannen zurückgezogen, was die Bildung eines nachhaltigen Trends erschwert. Zweitens dämpfen niedrige Zinsen die Volatilität. In einem Niedrigzinsumfeld sinkt die Risikobereitschaft des Kapitals, kurzfristige spekulative Kapitalflüsse nehmen ab, und den Wechselkursen fehlt die finanzielle Unterstützung, die für die Bildung eines Trends erforderlich ist. Drittens hat sich die Marktstruktur verändert. Seit der Insolvenz von FX Concepts, einem renommierten globalen Devisenfonds, im Jahr 2013 sind große, auf Devisentrendhandel spezialisierte Fondsmanager praktisch verschwunden. Diese Fonds, einst eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung langfristiger Wechselkurstrends, haben die richtungsweisende Wirkung des Marktes weiter geschwächt und einen Teufelskreis aus „Trendlosigkeit – Fondsentzug – schwächerer Trend“ geschaffen.
Die Kernmerkmale des aktuellen Devisenmarktes haben sich von „trendgetrieben“ zu „konsolidierungsgetrieben“ verschoben. Die meisten Währungspaare schwanken über längere Zeiträume innerhalb fester Spannen, und auf Durchbrüche durch wichtige Niveaus folgen oft „falsche Ausbrüche“ (d. h. schnelle Rückschläge, die keinen Trend etablieren). Breakout-Trading-Strategien generieren nicht nur keine Gewinne, sondern neigen auch dazu, aufgrund von Fehlausbrüchen Stop-Loss-Orders auszulösen, was zu anhaltenden Verlusten führt. Dieser Wandel im Marktumfeld hat dazu geführt, dass sich Breakout-Trading-Methoden von einer „effektiven“ zu einer „risikoreichen“ Strategie entwickelt haben, was letztlich dazu führte, dass Händler sie nach und nach aufgeben.
Zusammenfassung: Neugestaltung der Forex-Trading-Wahrnehmung und Anpassung von Strategien.
Die aktuellen Merkmale des Forex-Marktes – geringes Risiko, geringe Rendite, fehlender Trend und dominante Konsolidierung – sind im Wesentlichen das Ergebnis der kombinierten Effekte der Geldpolitik der globalen Zentralbanken, der Wechselkursinterventionsstrategien und der Marktstruktur. Händler müssen ihr Verständnis des Forex-Marktes grundlegend überdenken: Sie müssen die Erwartung aufgeben, „kurzfristig viel Geld zu verdienen“, und stattdessen die Natur der „geringe Rendite und langsamen Akkumulation“ akzeptieren. Sie sollten auch ihre Handelsstrategien anpassen und von „Trend-Trading und kurzfristiger Spekulation“ zu „Range-Trading und Swing-Trading“ wechseln. Durch die Nutzung kleiner Chancen innerhalb enger Schwankungen und die strikte Kontrolle von Positionen und Stop-Loss-Orders können sie langfristige, stabile Gewinne erzielen.
Sofern es nicht zu einer grundlegenden Veränderung der globalen Geldpolitik kommt (wie etwa einem kollektiven Ausstieg aus den Niedrigzinsen und der Aufgabe von Wechselkursinterventionen durch die großen Zentralbanken), werden die Merkmale des Devisenmarktes – geringes Risiko, geringe Rendite und starke Konsolidierung – bestehen bleiben. Die Kernkompetenz der Händler wird nicht mehr die Fähigkeit sein, Trends zu erkennen, sondern die Fähigkeit, sich an einen volatilen Markt anzupassen und Risiken zu kontrollieren.
Im globalen Devisenmarkt mit zwei Richtungen sind die acht Hauptwährungen (US-Dollar, Euro, Yen, Britisches Pfund, Australischer Dollar, Kanadischer Dollar, Schweizer Franken und Neuseeland-Dollar) die wichtigsten Handelsziele für Händler.
Dieses Phänomen ist nicht nur auf den globalen Einfluss der Volkswirtschaften hinter diesen Währungen zurückzuführen, sondern hängt auch eng mit der Devisenpolitik ihrer Ausgabeländer/Währungszonen zusammen. Im Vergleich zu einigen Ländern mit strengen Devisenkontrollen verfolgen die Emittenten der acht Hauptwährungen in der Regel eine offene Devisenmanagementstrategie und ergreifen selten langfristige, systematische Devisenkontrollmaßnahmen. Diese politische Entscheidung beruht auf dem Vertrauen in ihre Wirtschaftskraft, den internationalen Status ihrer Währungen und die Reife ihrer Finanzmärkte. Anstatt sich auf die Blockierung von Devisenströmen zur Wahrung der Stabilität zu verlassen, können diese Währungen durch Offenheit größere globale wirtschaftliche Vorteile erzielen.
1. Ausreichende internationale Kreditwürdigkeit der Währung: Zur Aufrechterhaltung der Bestände sind keine Kontrollen erforderlich.
Der Hauptvorteil der acht Hauptwährungen liegt in ihrer starken internationalen Kreditwürdigkeit, wodurch administrative Kontrollen zur Erzwingung von Marktbeständen überflüssig werden. US-Dollar, Euro, Yen und Britisches Pfund, weltweit als „Hartwährungen“ anerkannt, machen zusammen über 90 % der globalen Devisenreserven aus und dienen den Zentralbanken als zentrale Instrumente für die Reserveallokation, die Abwicklung des internationalen Handels und grenzüberschreitende Investitionen. Obwohl der Australische Dollar, der Kanadische Dollar, der Schweizer Franken und der Neuseeländische Dollar nicht zu den wichtigsten Reservewährungen zählen, haben ihre stabilen wirtschaftlichen Fundamentaldaten (wie die starke Korrelation zwischen dem Australischen Dollar und den Rohstoffpreisen sowie die Eigenschaft des Schweizer Frankens als sicherer Hafen) sie zu „sekundären Hartwährungen“ gemacht, die globale Investoren und Händler gerne aktiv halten.
Diese Bereitschaft, Währungen aktiv zu halten, macht es für die Emittenten der acht Hauptwährungen überflüssig, Devisenreserven durch Regulierung zu „binden“. Beispielsweise wird der globale Ölhandel in US-Dollar abgewickelt, während der Handel innerhalb Europas und mit den Nachbarländern überwiegend in Euro abgewickelt wird. Die natürliche Marktnachfrage nach diesen Währungen hat einen „natürlichen Zufluss“ von Devisen geschaffen. Umgekehrt sendet die Einführung von Devisenkontrollen in solchen Volkswirtschaften ein negatives Signal an den Markt, das die begrenzte Währungsliquidität signalisiert. Handelspartner und Investoren befürchten daraufhin die Währungskonvertibilität und reduzieren die Nutzung der Währung. Dies schadet letztlich der langfristigen internationalen Kreditwürdigkeit der Währung und untergräbt ihre Wettbewerbsfähigkeit.
Zweitens: Stark nach außen orientierte Volkswirtschaften: Kontrollen wirken sich direkt auf Kernindustrien aus.
Die Volkswirtschaften der acht wichtigsten Währungsemittenten/Währungszonen sind alle stark nach außen orientiert, und ihre Kernindustrien sind in ihrer Entwicklung stark von den globalen Märkten abhängig. Devisenkontrollen stören ein zentrales Bindeglied im Konjunkturzyklus unmittelbar. Aus wirtschaftsstruktureller Sicht lassen sich die wichtigsten Einnahmequellen solcher Volkswirtschaften in drei Kategorien unterteilen: Die erste ist der Rohstoffexport (z. B. Australiens Abhängigkeit von Eisenerz- und Kohleexporten, Neuseelands Abhängigkeit von Agrarprodukten und Kanadas Abhängigkeit von Energie- und Mineralexporten). Ihre Exporterlöse machen in der Regel mehr als 20 % des BIP aus. Werden Devisenkontrollen eingeführt, um den Austausch von Exporterlösen einzuschränken, führt dies unmittelbar dazu, dass Unternehmen ihre lokalen Währungsreserven nicht mehr zeitnah zurückerhalten können, was sich negativ auf Produktion und Betrieb auswirkt. Ein zweiter Faktor sind grenzüberschreitende Investitionen (beispielsweise in den USA und Japan, wo inländische Unternehmen weltweit Produktions- und Vertriebsnetze aufgebaut haben und Auslandsumsätze einen sehr hohen Anteil ausmachen). Werden grenzüberschreitende Kapitalflüsse eingeschränkt, behindert dies Auslandsinvestitionen und die Gewinnrückführung von Unternehmen und schwächt so ihre globale Wettbewerbsfähigkeit. Ein dritter Faktor sind Finanzdienstleistungen (beispielsweise London, Großbritannien, als weltweit größter Devisenhandelsplatz und die Schweiz als Kernmarkt für Private Banking und Vermögensverwaltung). Der Kernwert dieser Finanzbranche liegt im freien Kapitalfluss. Werden Devisenkontrollen eingeführt, führt dies unmittelbar zum Verlust von Kunden für Finanzinstitute und zerstört die Grundlagen der Branche.
Nehmen wir Neuseeland als Beispiel. Agrarexporte machen über 30 % des BIP aus, und über 90 % dieser Exporte sind für den globalen Markt bestimmt. Können ausländische Importeure nicht frei in Neuseeland-Dollar bezahlen oder neuseeländische Exporteure Fremdwährungen nicht frei in Landeswährung umtauschen, führt dies unmittelbar zu nicht verkauften Agrarprodukten und einer inländischen Agrarkrise. Diese „tiefe Verflechtung der Wirtschaft mit den globalen Märkten“ bedeutet, dass die acht großen Währungsemittenten die Kosten der Devisenkontrollen nicht tragen können.
Drittens: Hohe Finanzmarktreife: Unabhängige Risikoabsicherungsmöglichkeiten.
Die acht großen Währungsemittenten/Währungsgebiete verfügen über die weltweit ausgereiftesten und tiefsten Finanzmärkte und sind in der Lage, Wechselkursschwankungen und Kapitalflussrisiken marktbasiert zu steuern, ohne auf regulatorische Risikovermeidung angewiesen zu sein. Aus Marktperspektive weisen die Finanzmärkte dieser Volkswirtschaften drei wesentliche Merkmale auf: Erstens sind sie groß (beispielsweise übersteigt der Markt für US-Staatsanleihen 30 Billionen US-Dollar und der Anleihenmarkt der Eurozone 20 Billionen US-Dollar), können große Kapitalzu- und -abflüsse bewältigen und sind weniger anfällig für starke Marktschwankungen aufgrund kurzfristiger Kapitalflüsse; zweitens verfügen sie über eine große Vielfalt an Instrumenten (entwickelte Märkte für Derivate wie Devisentermingeschäfte, Optionen und Swaps ermöglichen es Unternehmen und Investoren, sich durch Absicherungsinstrumente gegen Wechselkursrisiken abzusichern); und drittens verfügen sie über robuste regulatorische Rahmenbedingungen (darunter robuste makroprudenzielle politische Rahmenbedingungen wie die Instrumente zur Liquiditätsanpassung der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank sowie der Mechanismus zur Überwachung grenzüberschreitender Kapitalflüsse der britischen Finanzaufsichtsbehörde FCA), die es ihnen ermöglichen, Kapitalflüsse mit marktbasierten Mitteln zu lenken.
Wenn beispielsweise der Yen vorübergehend unter Abwertungsdruck steht, kann die Bank von Japan die Zinsen erhöhen, um die Rendite auf Yen-denominierte Vermögenswerte zu steigern. Dies zieht ausländisches Kapital an, um die Yen-Bestände zu erhöhen und so den Yen-Wechselkurs wieder anzukurbeln. Steht das britische Pfund unter Aufwertungsdruck, kann die Bank von England ihre Anleihekäufe ausweiten, um Liquidität freizusetzen, die Marktzinsen zu senken und übermäßige ausländische Kapitalzuflüsse einzudämmen. Diese „marktbasierte Regulierungskapazität“ macht es den acht großen Währungsemittenten überflüssig, Risiken durch administrative Kontrollen zu „blockieren“, und ermöglicht es ihnen stattdessen, Risiken durch Marktmechanismen auszugleichen.
Viertens: Kapitalströme erfordern eine bidirektionale Nachfrage: Die Öffnung folgt ihrer eigenen Entwicklungslogik.
Die Kapitalströme zwischen den acht großen Währungsemittenten weisen ein „bidirektionales Gleichgewicht“ auf, das sowohl „Kapitalabflüsse“ zur Erzielung globaler Erträge als auch „Kapitalzuflüsse“ zur Unterstützung der inländischen Entwicklung erfordert. Die Liberalisierung des Devisenhandels ist eine Voraussetzung für diesen Zyklus. Im Hinblick auf Kapitalabflüsse verfügen Volkswirtschaften wie die USA, Japan und Großbritannien über hohe inländische Kapitalbestände und müssen diese durch Auslandsinvestitionen erhöhen. So belaufen sich die Direktinvestitionen der USA beispielsweise auf über 6 Billionen US-Dollar und die Japans auf über 3 Billionen US-Dollar. Die aus diesen Investitionen repatriierten Gewinne sind ein wichtiger Motor des jeweiligen Wirtschaftswachstums. Die Einführung von Devisenkontrollen zur Begrenzung des Kapitalabflusses würde diese Einnahmequelle blockieren. Im Hinblick auf Kapitalzuflüsse benötigen Volkswirtschaften wie die Eurozone, Kanada und Australien ausländische Investitionen, um die Modernisierung der heimischen Industrie und den Ausbau der Infrastruktur zu unterstützen. Die Eurozone beispielsweise fördert den industriellen Wandel durch die Anziehung ausländischer Investitionen in neue Energien und hochwertige Fertigung, während Australien ausländische Investitionen zur Erschließung seiner Bodenschätze anzieht. Eine Beschränkung des Kapitalzuflusses würde zu unzureichenden Inlandsinvestitionen führen und das Wirtschaftswachstum bremsen.
Nehmen wir die USA als Beispiel. Inländische Unternehmen müssen Kapital in wachstumsstarken Märkten weltweit (wie Südostasien und Lateinamerika) investieren, um hohe Renditen zu erzielen. Zudem müssen ausländische Investoren US-Staatsanleihen, Aktien und andere Vermögenswerte kaufen, um die US-Regierung und Unternehmen zu finanzieren. Diese Logik der „gegenseitigen Kapitalströme und gegenseitigen Unterstützung“ macht eine Liberalisierung des Devisenmarktes für die acht großen Währungsemittenten unausweichlich. Regulierung würde nicht nur Kapitalabflüsse einschränken, sondern auch Kapitalzuflüsse blockieren und letztlich den Konjunkturzyklus schädigen.
V. Internationale Regeln und Kreditbeschränkungen: Regulierung wird die globale Diskursmacht untergraben.
Die acht großen Währungsemittenten sind überwiegend Industrieländer (wie G7- und OECD-Mitglieder). Sie sind die primären Gestalter und Teilnehmer globaler Wirtschaftsregeln. Ihre politischen Entscheidungen müssen mit den von ihnen präsidierten internationalen Regeln im Einklang stehen und gleichzeitig ihr eigenes „Kreditimage“ wahren. Aus Sicht internationaler Regeln haben diese Volkswirtschaften seit dem Zweiten Weltkrieg den Aufbau einer internationalen Wirtschaftsordnung vorangetrieben, die auf dem freien Kapitalverkehr basiert (Artikel VIII des IWF-Abkommens fordert die Mitgliedsländer beispielsweise auf, Devisenkontrollen in den Leistungsbilanzen abzuschaffen, und der Kapitalliberalisierungskodex der OECD verpflichtet die Mitgliedsländer zur Öffnung ihrer Kapitalkonten). Die Einführung von Devisenkontrollen wäre ein Regelbruch und würde ihre Rolle in der globalen Wirtschaftsordnung schwächen. Aus Kreditsicht liegt einer der zentralen Wettbewerbsvorteile dieser Volkswirtschaften in ihrer politischen Stabilität und Vorhersehbarkeit. Die plötzliche Einführung von Devisenkontrollen würde das Vertrauen der Märkte in ihre Politik untergraben und eine Kreditkrise auslösen.
Nehmen wir zum Beispiel die Schweiz. Das wichtigste Verkaufsargument ihres Private-Banking-Sektors ist die Freiheit, Vertraulichkeit und Sicherheit des Kapitals. Rund ein Drittel des weltweit grenzüberschreitenden Privatvermögens wird von Schweizer Banken verwaltet. Würde die Schweiz Devisenkontrollen einführen, würde dies das Vertrauen der Kunden in die Sicherheit und Liquidität ihrer Gelder direkt untergraben, einen massiven Kapitalabfluss auslösen und die Vermögensverwaltungsbranche zerstören. Diese Notwendigkeit, „internationale Regelbeschränkungen einzuhalten und ein Kreditwürdigkeitsimage aufrechtzuerhalten“, stärkt die acht großen Währungsemittenten zusätzlich devisenliberalisierungspolitik.
Zusätzliche Informationen: Es handelt sich nicht um eine „absolute Nichtintervention“, sondern um eine „Notstandsregulierung“.
Es sei klargestellt, dass die acht großen Währungsemittenten nicht „vollständig auf Interventionen am Devisenmarkt verzichten“. Vielmehr vermeiden sie die Einführung „langfristiger, pauschaler“ Devisenkontrollen. Sie ergreifen nur unter extremen Marktbedingungen „vorübergehende, marktbasierte“ Regulierungsmaßnahmen. Die Kernmerkmale dieser Maßnahmen sind ihre Kurzfristigkeit und Zielgerichtetheit. So hob die Schweizerische Nationalbank 2015 aufgrund der Übertragung des Euro-Abwertungsdrucks durch die quantitative Lockerung der Eurozone vorübergehend die Franken-Euro-Bindung auf. Als das britische Pfund 1992 spekulativen Angriffen ausgesetzt war, reagierte die Bank of England auf die Kapitalabflüsse mit einer deutlichen Zinserhöhung (zeitweise sogar mit 15 %). Zu Beginn der Pandemie 2020 schloss die Federal Reserve Währungsswap-Vereinbarungen mit mehreren Zentralbanken ab, um die angespannte US-Dollar-Liquidität zu entschärfen. Diese Maßnahmen sind „Notfallmaßnahmen“ und werden beendet, sobald die Marktstabilität wiederhergestellt ist. Sie stellen keine langfristige Regulierungspolitik dar, und ihr Hauptziel bleibt die „Wahrung der Marktoffenheit“.
Zusammenfassung: Die Kernlogik der Devisenpolitik – „Vertrauen bestimmt die Strategie.“
Ob ein Land oder eine Währungszone Devisenkontrollen einführt, hängt maßgeblich vom wirtschaftlichen Vertrauen ab. Das Vertrauen der acht wichtigsten Währungsemittenten beruht auf drei Faktoren: der internationalen Glaubwürdigkeit ihrer Währungen (keine Notwendigkeit von Pflichtbeständen), der globalen Wettbewerbsfähigkeit ihrer exportorientierten Volkswirtschaften (Kontrollen würden ihre finanziellen Ressourcen abschneiden) und den Risikomanagementfähigkeiten ihrer reifen Finanzmärkte (keine Notwendigkeit, Risiken zu vermeiden). Daher kann die Liberalisierung der Devisenströme mehrere Vorteile bringen: Sie zieht ausländische Investitionen an, fördert den Handel und stärkt das Ansehen der Währung. Einige Länder führen jedoch Devisenkontrollen ein, da ihre Devisenreserven unzureichend sind, die Finanzmärkte instabil sind und die Wirtschaft stark vom Devisenhandel abhängig ist. Ihnen fehlt jedoch die nötige Wettbewerbsfähigkeit. Kurzfristige Stabilität können sie nur erreichen, indem sie Kapitalabflüsse durch Kontrollen blockieren.
Kurz gesagt: Die Wahl der Devisenpolitik spiegelt Stärke wider: Länder mit starker Wirtschaft, ausreichender monetärer Glaubwürdigkeit und reifen Märkten wagen es, die globalen Vorteile der Öffnung zu nutzen; Länder mit geringerer Stärke und geringerer Risikoresistenz können hingegen nur kurzfristige Sicherheit durch Kontrollen erreichen. Die offene Devisenpolitik der acht großen Währungsemittenten spiegelt ihren globalen wirtschaftlichen Status direkt wider.
 13711580480@139.com
13711580480@139.com
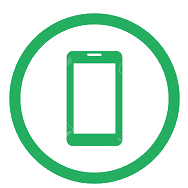 +86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
 +86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
 +86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
 z.x.n@139.com
z.x.n@139.com
 Mr. Z-X-N
Mr. Z-X-N
 China · Guangzhou
China · Guangzhou



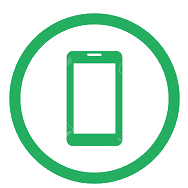 +86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
 +86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
 +86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
 Mr. Z-X-N
Mr. Z-X-N
 China · Guangzhou
China · Guangzhou